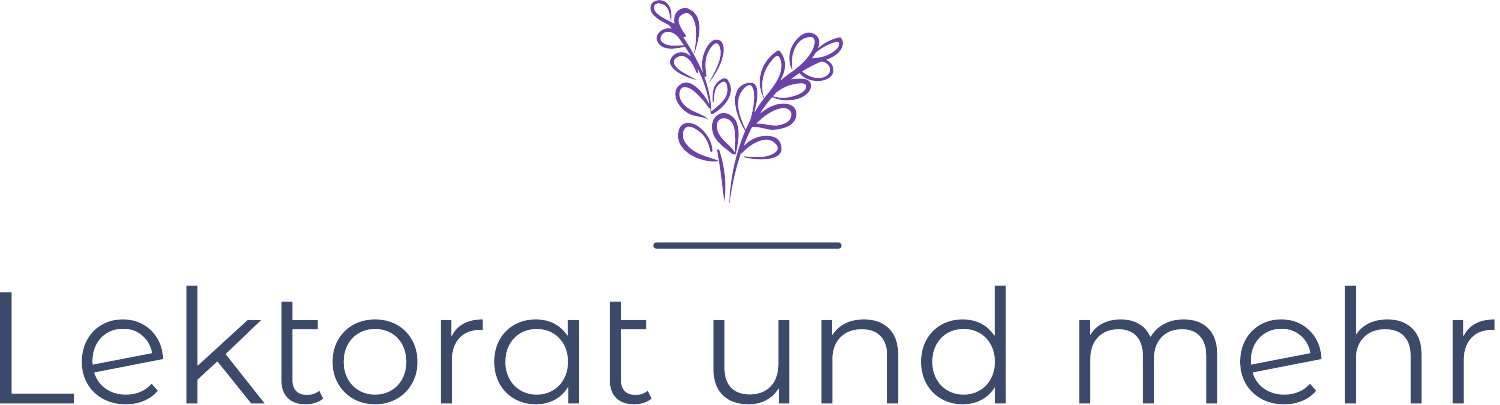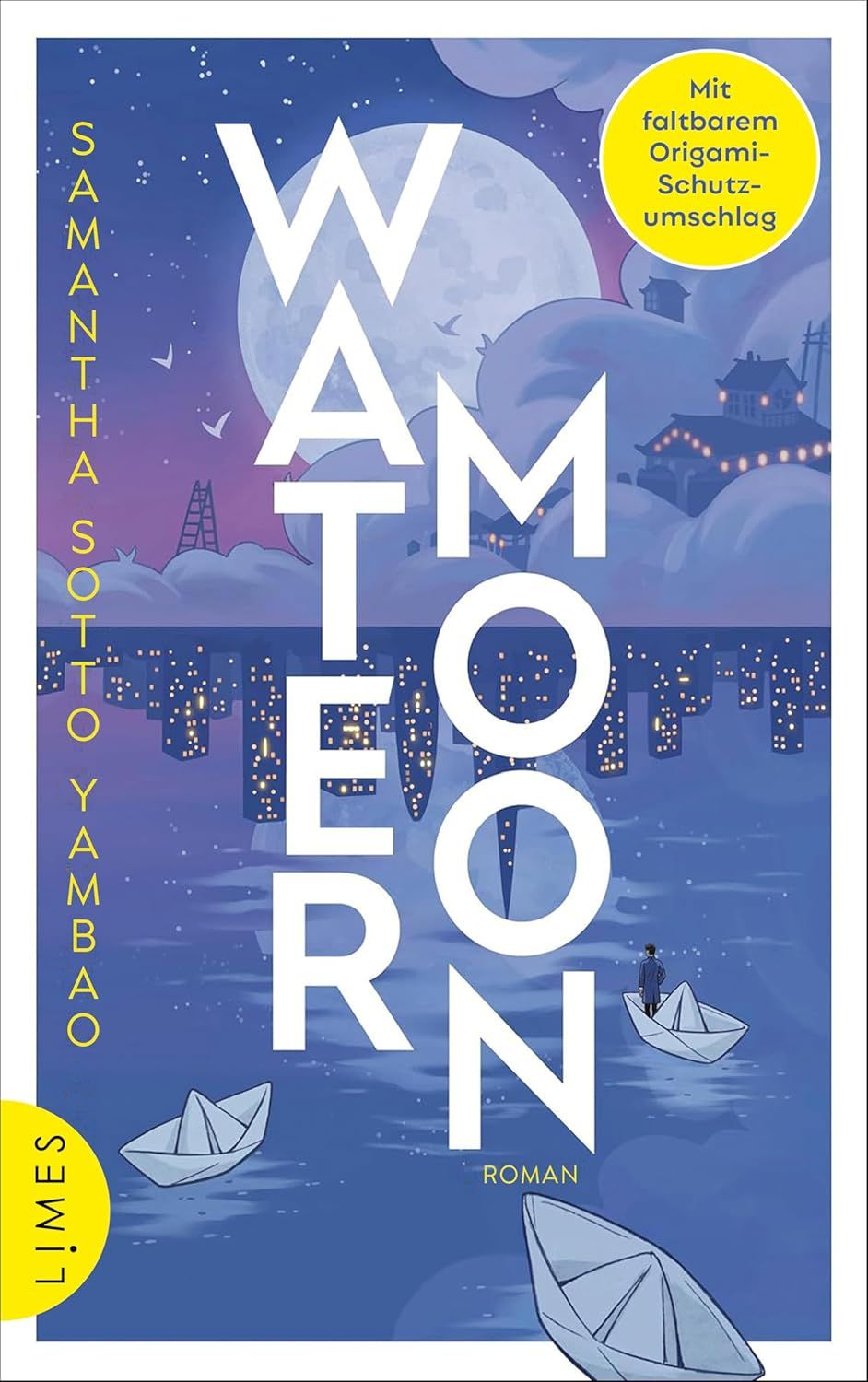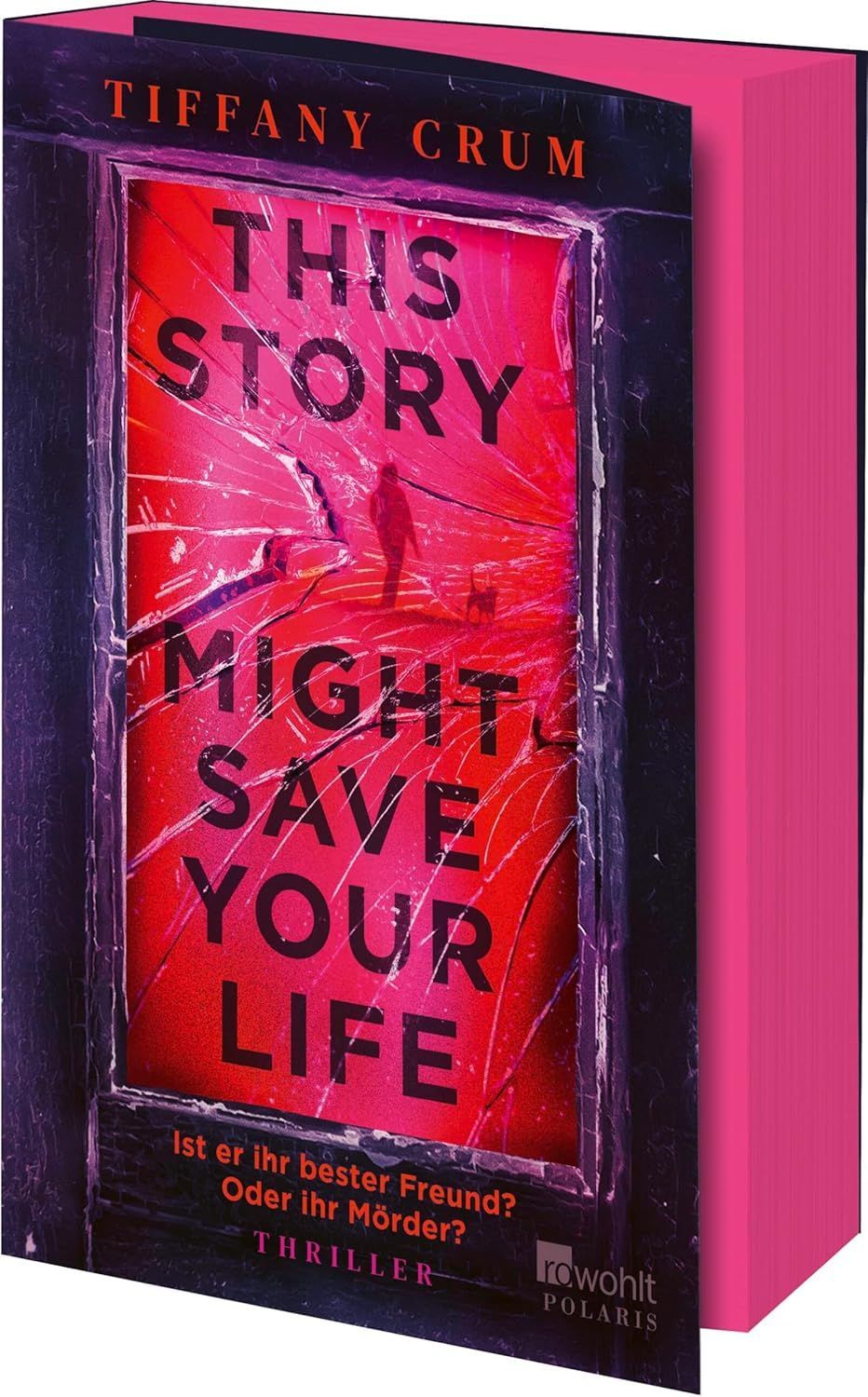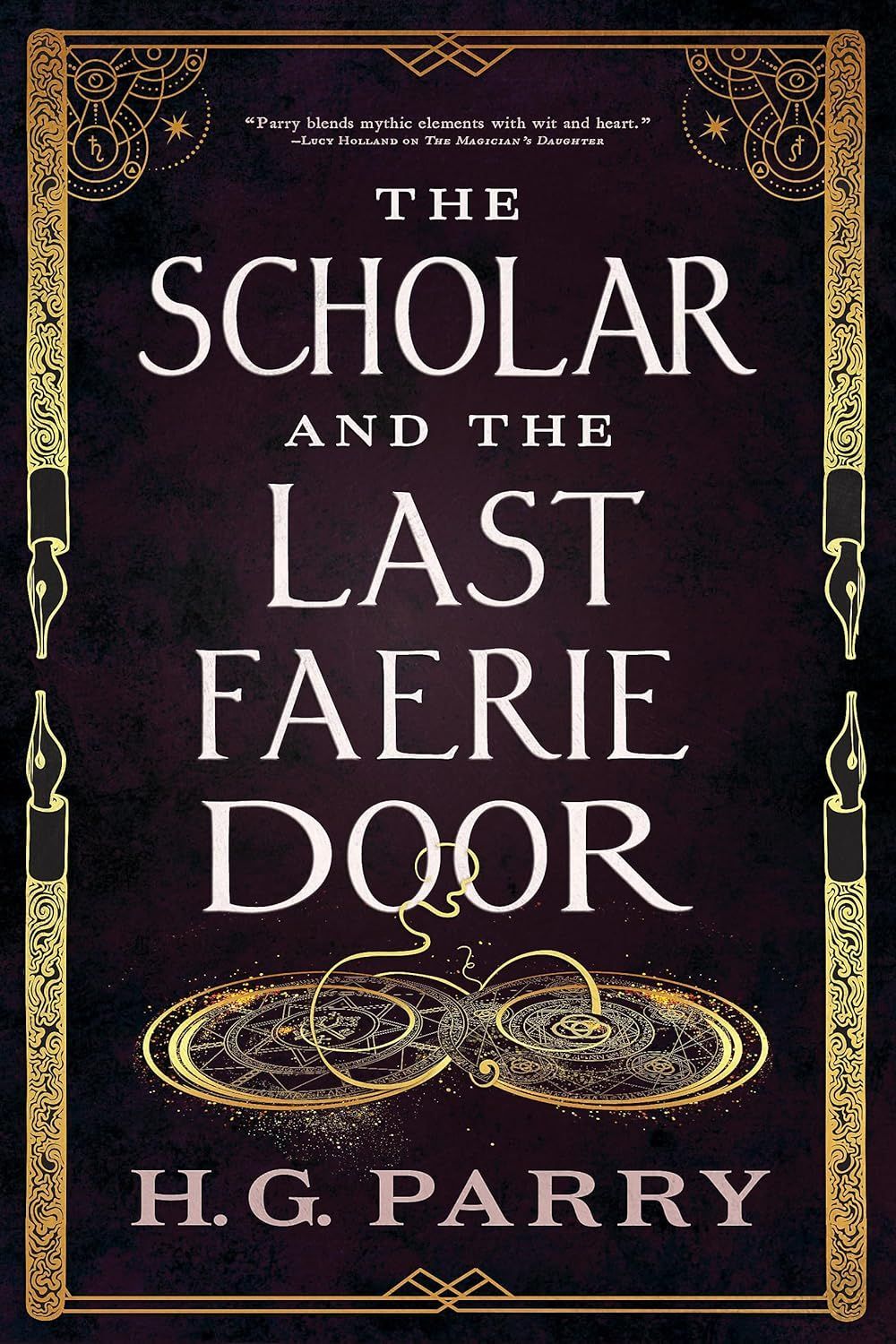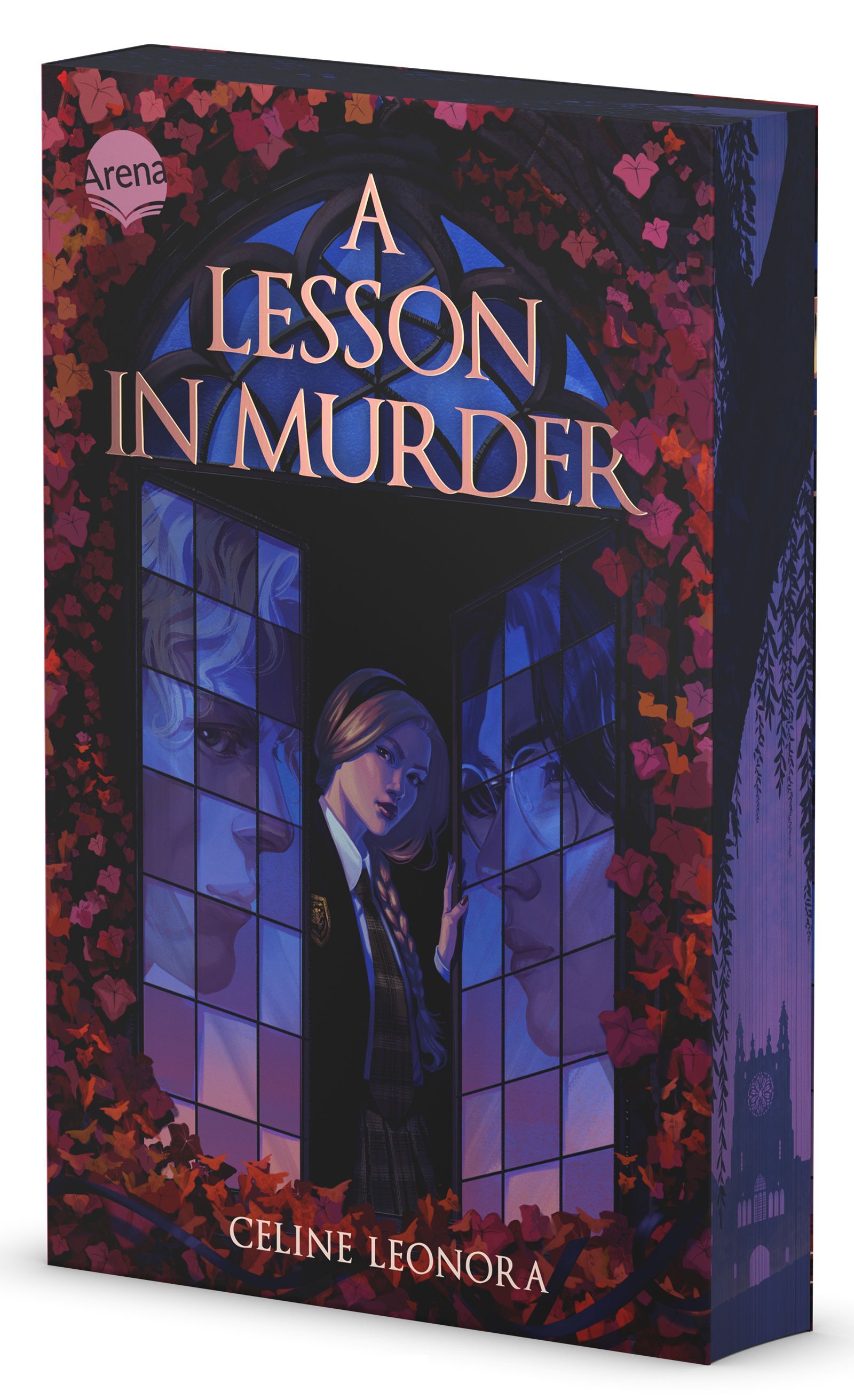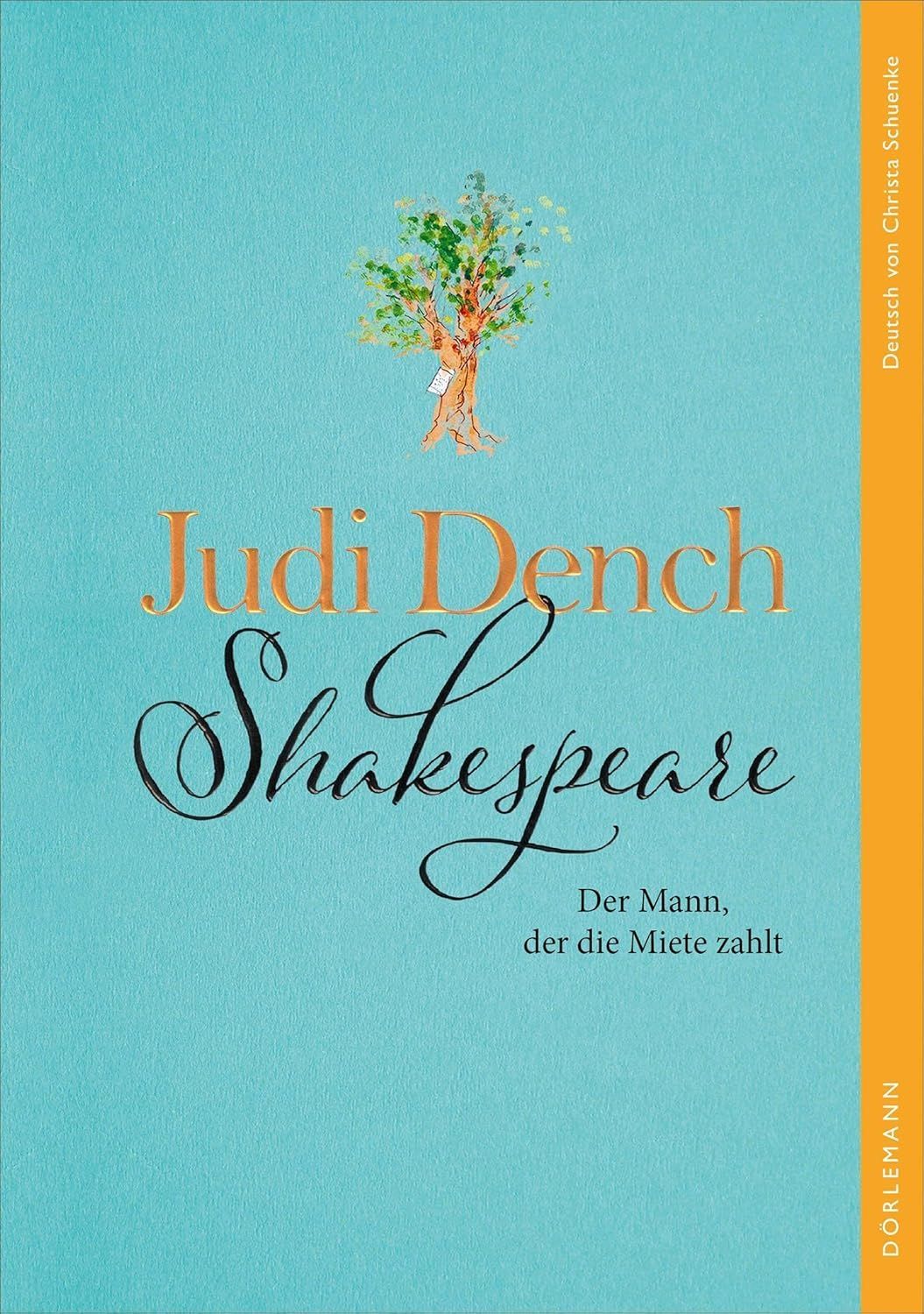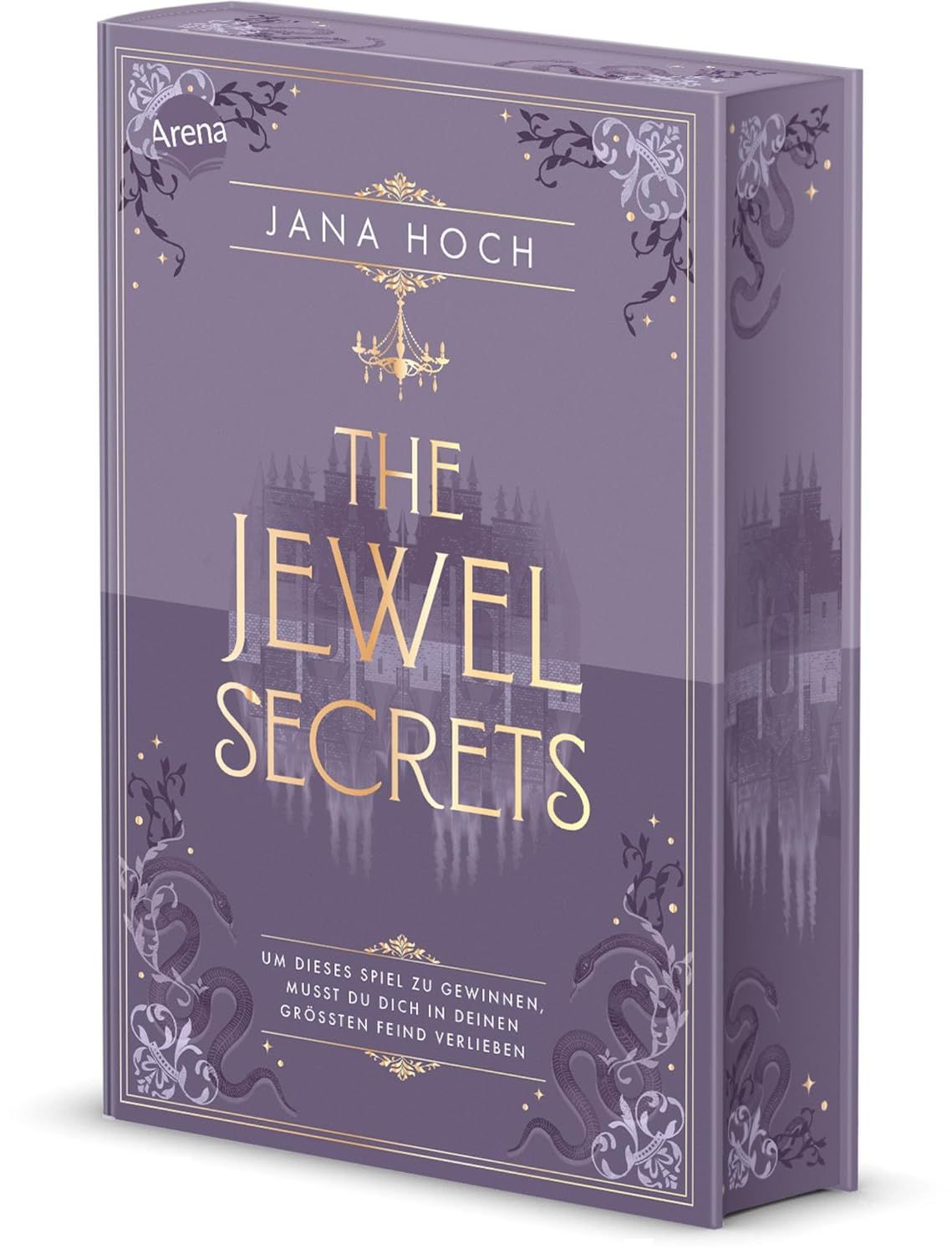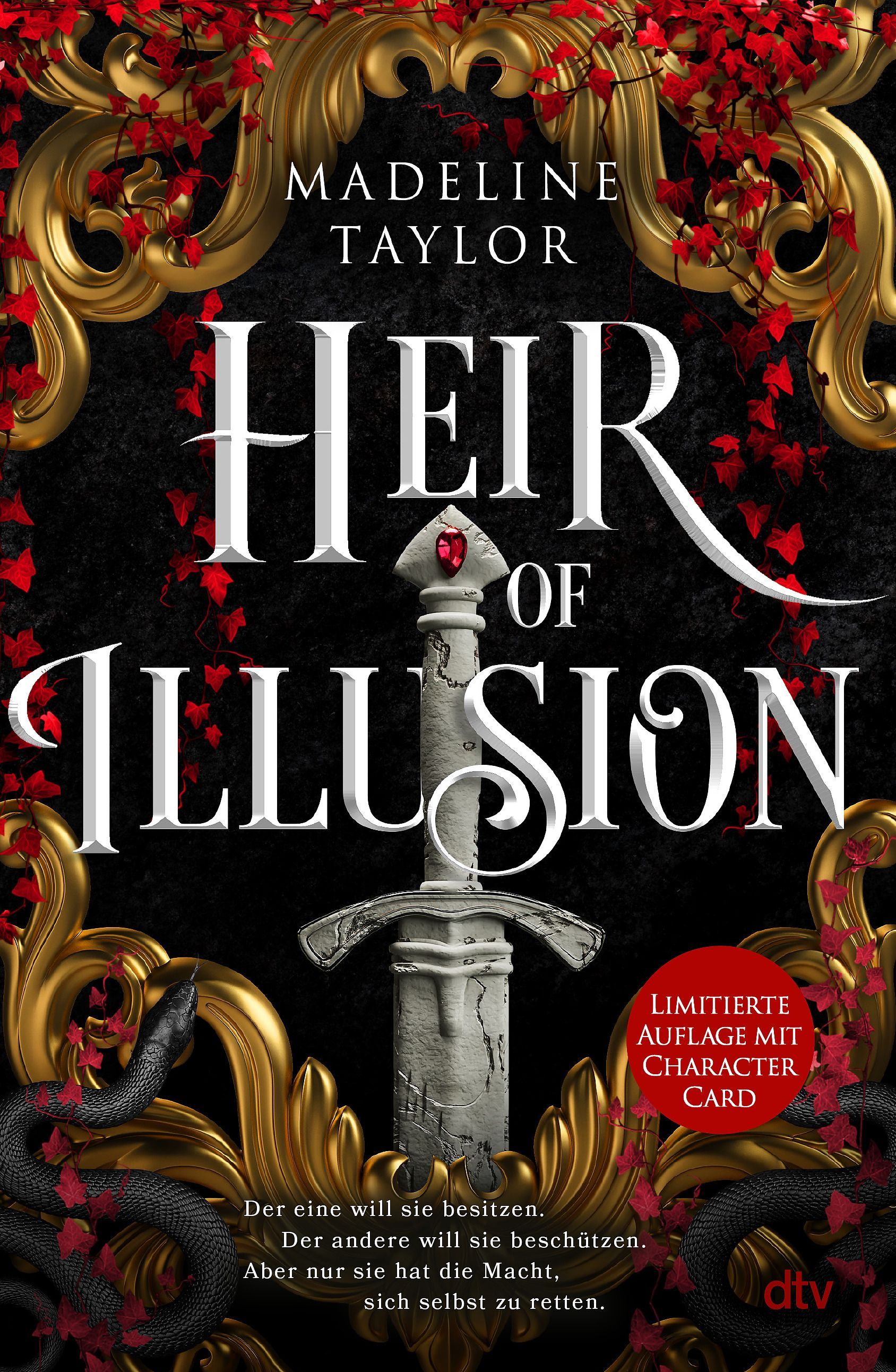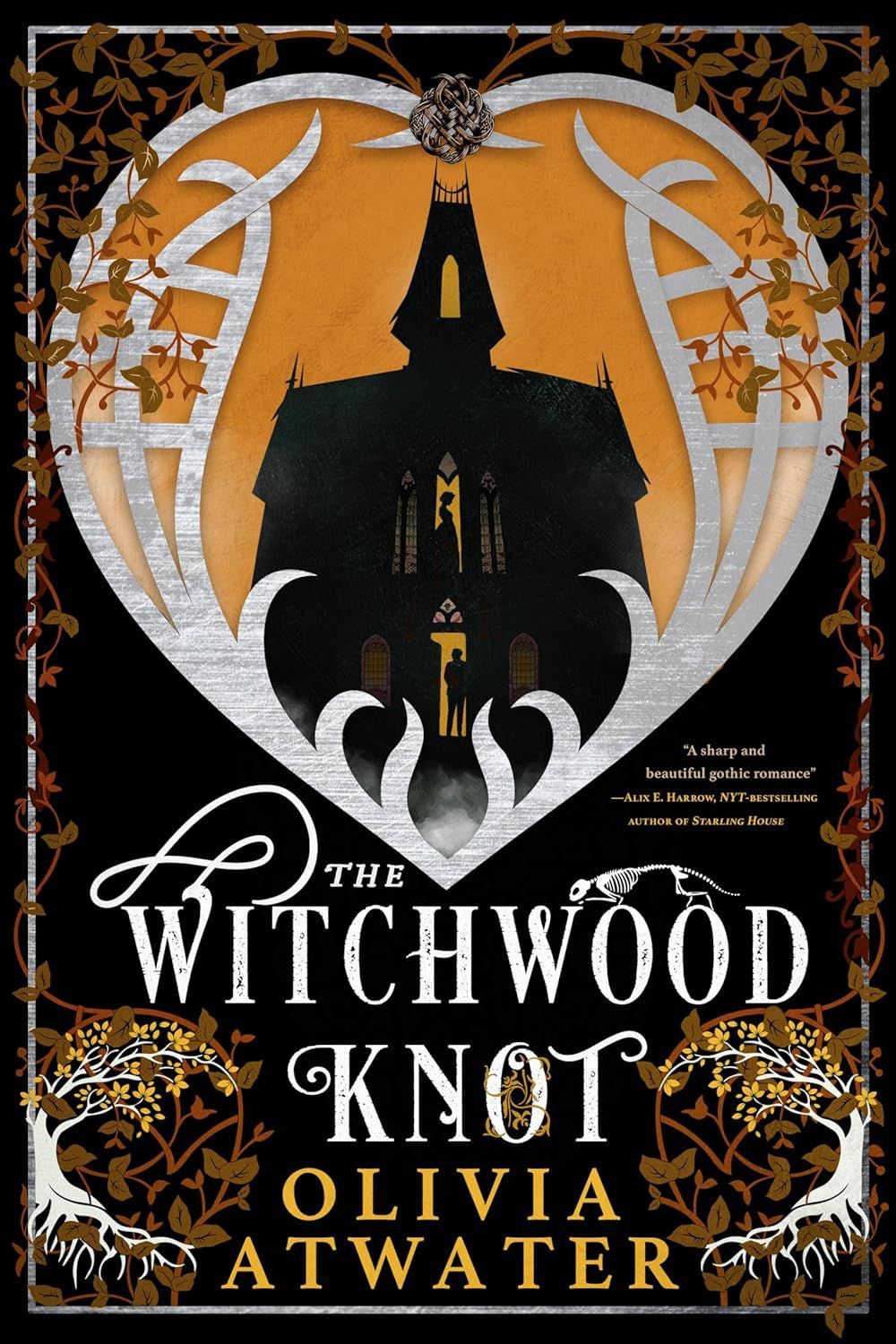Ich habe bereits andere Bücher von Lucy Fricke gelesen und schätze ihre Fähigkeit, Lebensbrüche und Krisen direkt und ungeschönt, zugleich aber mit feiner Beobachtungsgabe zu schildern. Auch in diesem Roman genügen ihr kurze Szenen, beiläufige Gesten und knappe Dialoge, um ganze Biografien anzudeuten.
Doch diesmal bleibt der Hoffnungsschimmer schwach. Judith hat sich emotional abgeschottet, um das Erlebte zu überstehen – und verletzt sich später selbst, nur um überhaupt noch etwas zu spüren. Fricke erzählt nicht chronologisch, sondern springt zwischen verschiedenen Lebensphasen. Das verstärkt das Gefühl von Orientierungslosigkeit, das auch Judith selbst durchzieht. Am Ende bleibt offen, wie es mit ihr weitergeht.
Besonders verstörend fand ich eine Begebenheit, bei der Judith einen Mitbewohner anleitet, wie er sich das Leben nehmen kann – und dass sein Tod beinahe wie ein Akt der Erlösung dargestellt wird. Das hat mich irritiert und nachdenklich zurückgelassen.
Trotz allem ist der Roman nicht völlig trostlos. Fricke findet immer wieder Momente von Zärtlichkeit, kleine Lichtblicke und einen leisen, dunklen Humor. Diese Kontraste machen das Buch sehr eindringlich.
Für mich war die Lektüre bedrückend – und genau deshalb wichtig. Die Gewalt, der Missbrauch, die verlorene Hoffnung: All das wirkt lange nach. Durst ist schlimmer als Heimweh ist sprachlich stark, thematisch aber schwer auszuhalten. Kein Buch für zwischendurch – aber eines, das nachhallt.
Lucy Fricke: Durst ist schlimmer als Heimweh
Ursprünglich erschienen am 1.9.2007 bei Piper als Debütroman der Autorin.Neu veröffentlicht am 30.10.2025 bei Ullstein. Bildrechte: Ullstein